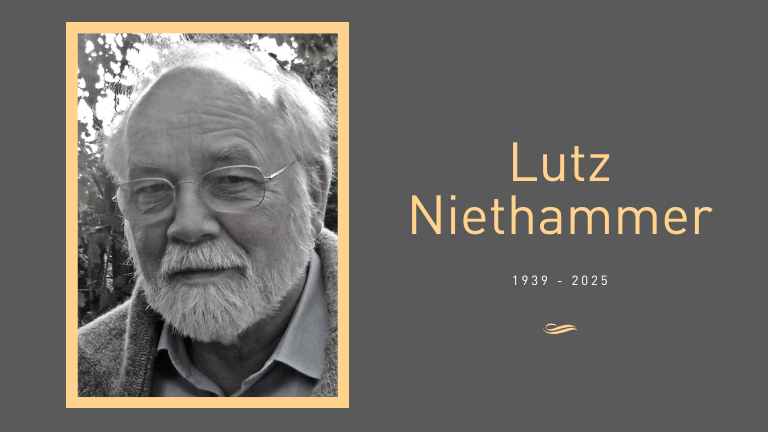Filia + Filius hieß die Zeitung, die Schülerinnen und Schüler der beiden Gymnasien von Stuttgart-Feuerbach vier Mal jährlich gemeinsam herausbrachten. Zum 17. Juni 1957 war ein „Sonderheft“ über die „Wiedervereinigung Deutschlands“ geplant, und die Redaktion stand unter Druck, weil sechs Tage vor Redaktionsschluss noch viele Illustrationen fehlten. Also trat sie an den Verein „Der Bürger im Staat“ heran. Der Schüler Lutz Niethammer forderte bei der Vorläufereinrichtung der Landeszentrale für politische Bildung Druckvorlagen von Fotos und Karikaturen an, die prompt geliefert wurden.
Zwei Charakteristika, die in eine der ungewöhnlichsten Historikerlaufbahnen ihrer Zeit münden sollten, sind in diesem Zufallsfund bereits deutlich erkennbar: Ein gehöriges Selbstbewusstsein des damals 17jährigen („lassen Sie uns postwendend wissen“) traf auf einen stark entwickelten Sinn fürs Politische – denn so unschuldig das Thema des Sonderhefts aus heutiger Sicht auch klingen mag, so brisant war es im Sommer 1957: Konrad Adenauers Popularität war auf ihrem Höhepunkt angelangt, und wer unter den Jüngeren genau damit haderte, deutete auf die kompromisslose Westbindungspolitik des Kanzlers, welche die Wiedervereinigung zu blockieren schien. Und weil im September Bundestagswahlen anstanden, dürfte das Sonderheft hitzige Debatten ausgelöst haben.
Niethammer, der viele Jahre später Fragmente einer Autobiographie veröffentlichte, griff diese Episode zwar nicht auf. Aber seine mit „Ego-Histoire?“ betitelten „Erinnerungs-Versuche“ aus dem Jahr 2002 setzten mit einer nicht minder politischen Reportage über ein Arbeitserziehungslager ein. Der „Jugendfunk“ des damaligen Südwestfunks hatte sie 1962 ausgestrahlt, und auch sie kündet vom politischen Engagement Niethammers, der zu dieser Zeit eigentlich Theologie studierte, sich aber längst in Richtung Zeitgeschichte zu orientieren begonnen hatte. Dahinter stand die Erfahrung vieler „Achtundsechziger“: Kaum jemand von den Älteren mochte Details über das Gestapo-Konzentrationslager in der dörflichen Nachbarschaft nennen, und Niethammers Vater war nicht nur NSDAP-Mitglied gewesen, sondern hatte als Grafiker auch die ästhetischen Vorgaben des „tausendjährigen Reiches“ adaptiert, ehe er Soldat wurde und spät erst aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte. In seiner essayistischen Collage autobiographisch reflektierender Texte führte Niethammer, der bis zum zwölften Lebensjahr vaterlos aufgewachsen war, seine eigene Skepsis gegenüber den Autoritätsansprüchen und hierarchischen Verhältnissen im akademischen Betrieb auch auf Verhaltens- und Beziehungsmuster zurück, die er in der eigenen Familie beobachtet hatte.
Dass der Sohn seine Dissertation über die als unzureichend empfundene Praxis der Säuberung nach dem Krieg schrieb („Entnazifizierung in Bayern“ von 1972, zehn Jahre später unter dem markanteren Titel „Die Mitläuferfabrik“ neu aufgelegt), hatte aber nicht nur mit dem zeittypischen Generationskonflikt zu tun. Die Arbeit entstand auch vor dem Hintergrund des starken Wählerzulaufs zur NPD, gerade in Baden-Württemberg, wo die Rechtsradikalen im April 1968 auf knapp zehn Prozent der Stimmen kamen. Niethammer schaute nicht nur auf Programmatik und agitatorische Praxis der NPD, sondern analysierte auch ihre parlamentarische Arbeit in sieben Landtagen und brachte im Sommer 1969 (also erneut: kurz vor der Bundestagswahl) sein Fischer-Taschenbuch „Angepasster Faschismus“ heraus.
Möglich war dies auch, weil Hans Mommsen, dem er bereits im Vorjahr als Assistent von Heidelberg nach Bochum gefolgt war, ein ganz ähnliches, stark auf gegenwärtige Verhältnisse orientiertes Verständnis von Zeitgeschichtsschreibung vertrat. Dies passte glänzend in das Klima der Reformuniversitäten, und schon 1973 wurde Niethammer als 33jähriger an die soeben gegründete Gesamthochschule Essen berufen; 1983 ging er an die Fernuniversität Hagen, ehe er 1993 schließlich den Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte in Jena übernahm.
Niethammer war ein wichtiger Wegbereiter der auf lebensgeschichtliche Interviews gestützten Oral History im deutschen Sprachraum, vor allem mit dem Essener LUSIR-Projekt („Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930-1960“), das eigentlich der Alltagserfahrung der gewöhnlichen Deutschen in der Diktatur und ihrem Zeitempfinden nachzuspüren gedachte. Entsprechend traten seit 1987 weitere Interviewprojekte in den Industrierevieren der DDR hinzu („Volkseigene Erfahrung“, 1990). Neben der neuen Methode etablierten diese Vorhaben zugleich neue Themen der akademischen Geschichtsschreibung, vom kommunistischen Widerstand über die Zwangsarbeit bis hin zur Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma. Die Perspektive „von unten“ stellte Niethammer auch den intellektuellen Großentwürfen aus dem dezisionistischen Geist der Zwischenkriegszeit entgegen: Im Wendejahr 1989 erschien „Posthistoire“, das sich energisch gegen die aufkommende Rede vom „Ende der Geschichte“ positionierte. Es schöpfte auch aus dem Materialfundus eines Erschließungsprojekts beim damaligen Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, das den Nachlass Carl Schmitts für die Forschung zugänglich machte. Ähnlich skeptisch blickte Niethammer an der Jahrtausendwende auch auf die intellektuellen Ursprünge der politisch immer bedeutsamer werdenden Identitäts-Konzepte („Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur“, 2000), denen er am Beispiel von Carl Schmitt, Georg Lukács, Sigmund Freud, Maurice Halbwachs und Aldous Huxley nachspürte.
In seinem eigentlichen Element war Niethammer, wenn es Institutionen auf- oder umzubauen galt. Das zeigte sich früh an der Essener Gesamthochschule, wo Niethammer als Konrektor für Studium und Lehre die Struktur für das heutige Akademische Beratungs-Zentrum schuf, und ebenso bei der Alten Synagoge in Essen, deren Nutzung als Gedenk- und Ausstellungsort er Anfang 1979 gemeinsam mit Detlev Peukert vorantrieb. Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten setzte Niethammer gemeinsam mit Reinhard Rürup und Jürgen Reulecke die im Herbst 1979 politisch heftig umkämpfte Ausschreibung über den „Alltag im Nationalsozialismus“ durch. Sie motivierte 12.500 Schülerinnen und Schüler dazu, über 2.000 Arbeiten einzureichen. Nach diesem Vorbild wurden Geschichtswettbewerbe ab 1991 auch zum kulturpolitischen Bestandteil der Internationalen Bauausstellung Emscher Park, zu deren Programmatik Niethammer ebenso aktiv beitrug wie zum Erhalt der Zeche Zollverein XII, für die er ein Nutzungskonzept als historisches Museum entwarf. Die Selbstanerkennung des Ruhrgebiets unter dem Leitbegriff der „Industriekultur“ hätte es ohne solche Initiativen Niethammers und seiner Schüler kaum gegeben.
In dieser politisch-institutionellen Wirksamkeit liegt das Außergewöhnliche an der Laufbahn Lutz Niethammers. Begünstigt wurde sie von engen Kontakten in die nordrhein-westfälische Sozialdemokratie, wo sich gerade jüngere Reformer wie Bodo Hombach, Tilman Fichter oder Anke Brunn auf Niethammers wissenschaftliche Positionen bezogen. Als Hombach 1998 schließlich Kanzleramtsminister wurde, war es deshalb kein Zufall, dass er Niethammer bei den Verhandlungen über die jahrzehntelang blockierte Entschädigung früherer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter als historischen Berater heranzog, dessen Vorschläge in die im Jahr 2000 eingerichtete Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ mit eingingen.
Das Ruhrgebiet war ein Glutkern von Lutz Niethammers Leidenschaft für Institutionen und wissenschaftspolitische Mitgestaltung. 1985 verkündete Johannes Rau in seiner Regierungserklärung eine neue NRW-Stiftung sowie die Gründung des KWI in Essen und des Instituts „Arbeit und Technik“ in Gelsenkirchen. Bei der Bewältigung des Strukturwandels sollte ein neuer Schwerpunkt auf Kultur, Medien und Wissenschaft gesetzt werden: „Wir brauchen die wissenschaftliche und gesellschaftliche Auseinandersetzung um eine sozialverträgliche Technik und um die wechselseitige Beeinflussung von Kultur und Technik“. Das KWI siedelte sich unter der Leitung des Gründungsdirektors Lutz Niethammer zunächst im alten Rathaus in Essen-Heisingen an. Hier entstand schnell ein universitäts-übergreifender Freiraum für Arbeitsgruppen und Gastwissenschaftler:innen, die eigenständig Veranstaltungen organisieren und Forschungsprojekte weitertreiben konnten. Dem interdisziplinär verfassten Kollegium des ersten Jahres gehörten etwa Martin Warnke und Sigrid Weigel, Barbara Duden, Walter Siebel und Heide Schlüpmann an.
Mittlerweile steht das KWI unter seiner vierten Direktion und hat seine Forschungsschwerpunkte immer wieder neu definiert, um dem Gründungsauftrag innovativer kulturwissenschaftlicher Forschung in NRW gerecht zu werden. In den Geistes- und Sozialwissenschaften hat es sich in jüngerer Zeit herumgesprochen, dass subjektive Perspektiven und Schreibweisen die Forschung bereichern können und dass es zivilgesellschaftliche Gruppen einzubeziehen gilt, um nicht allein Wissenschaft, sondern auch Demokratie zu verteidigen. Unser Gründungsdirektor Lutz Niethammer diagnostizierte sich selbst in seiner „Ego-Histoire“ aus dem Jahr 2002 zwar „einen Mangel an thematischer und methodischer Kohärenz“, der auch seiner Leidenschaft für politische Interventionen geschuldet gewesen sei. Aus heutiger Perspektive lässt sich aber in vielfältiger Weise an seine kritische Selbstreflexion anschließen, um neue Beziehungen zwischen Kultur und Technik innerhalb gefährdeter demokratischer Verhältnisse zu verstehen. Es lohnt sich, Lutz Niethammer wiederzulesen, der Ende Juli im Alter von 85 Jahren in Berlin verstorben ist.
Julika Griem und Tim Schanetzky